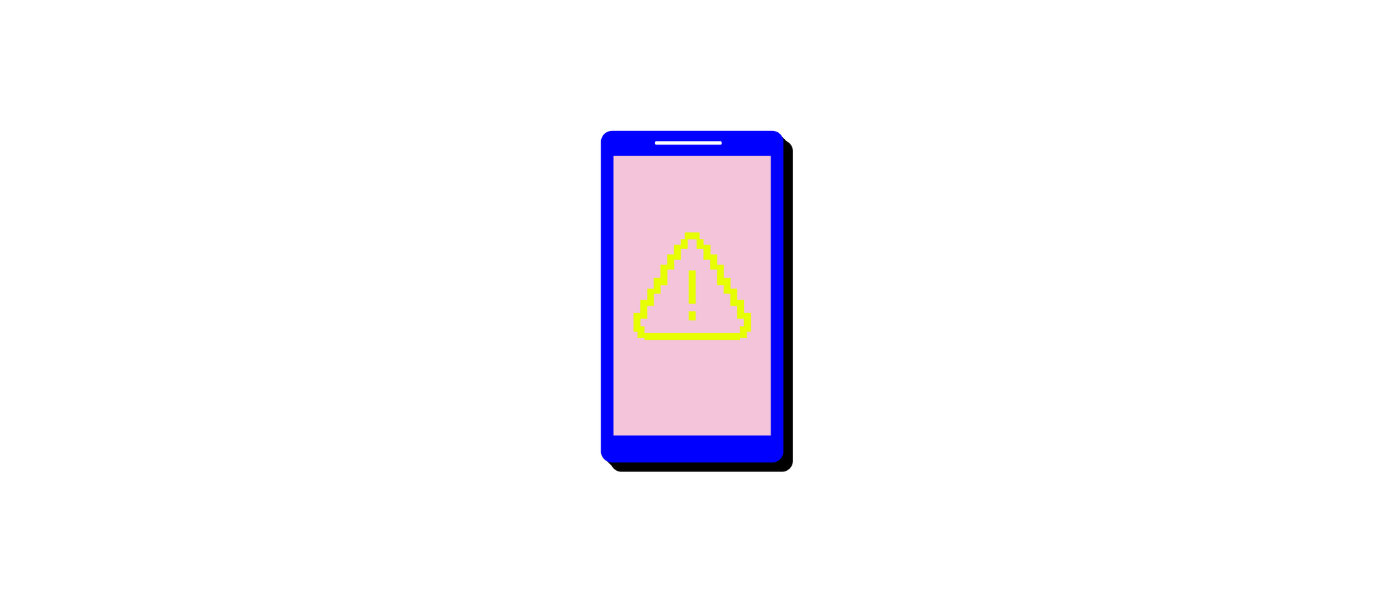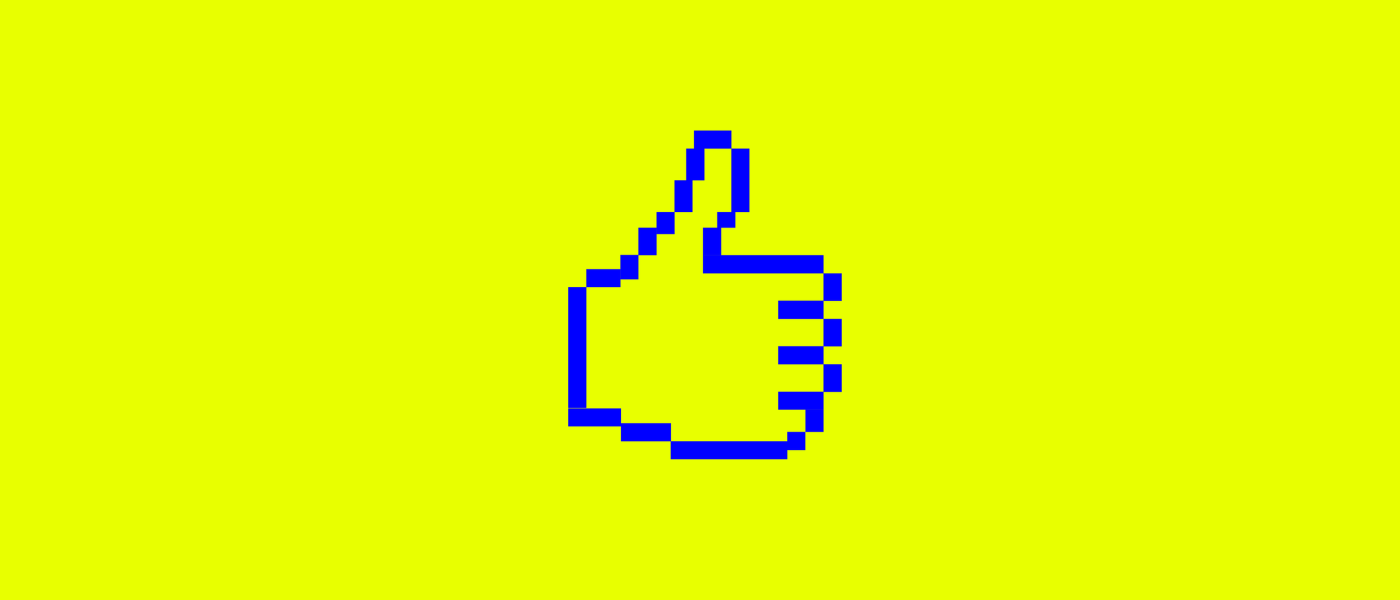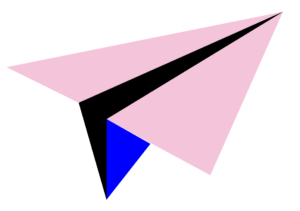Fast alle EU-Staaten sprechen sich für ein Mindestalter von 15 Jahren im Netz aus.
Die neue „Jutland Declaration“ soll Kinder und Jugendliche besser vor digitalen Risiken schützen. Doch wie lässt sich das in der Praxis umsetzen – und was bedeutet das für Schulen und Eltern?
Ein europäischer Weckruf
In Horsens (Dänemark) haben sich die Digitalminister:innen der EU auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt:
Mit der Jutland Declaration – Shaping a Safe Online World for Minors [1] fordern sie strengere Schutzmaßnahmen für Minderjährige im Netz.
Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen schlug dabei vor, ein digitales Mindestalter von 15 Jahren für soziale Medien zu prüfen. Ziel: den Einfluss manipulativer Plattformmechanismen einzudämmen und Kinder besser zu schützen.
Unterstützt wurde der Vorschlag von fast allen europäischen Staaten – auch Norwegen und Island unterzeichneten. Nur Estland und Belgien lehnten ab.
Parallel dazu prüft die EU-Kommission im Rahmen des Digital Services Act (DSA), wie sicher Plattformen wie YouTube, Snapchat und der App Store wirklich sind [2].
Was die Erklärung fordert
Die Deklaration zeichnet ein klares Bild:
Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit online – oft in Räumen, die nicht für sie gemacht sind.
„Minderjährige sind erheblichen Risiken ausgesetzt – von Suchtmechanismen über schädliche Inhalte bis zu ungewollten Kontakten.“
(Jutland Declaration, 2025)
Gefordert werden deshalb:
-
verlässliche Altersverifikationssysteme,
-
datenschutzfreundliche Identitätsnachweise,
-
und ein technisches Design, das Jugendschutz von Anfang an mitdenkt („by design, by default“).
Als mögliche Lösungen nennt die Erklärung digitale Alters-Apps und die kommende EU-Digital-ID (EUDI Wallet). Diese könnte künftig auch zur Altersfreigabe im Netz dienen – datenschutzkonform, interoperabel und ohne zusätzliche Registrierung.
Zwischen Schutz und Kontrolle
Doch nicht alle teilen den Ansatz.
Estlands Digitalministerin Liisa-Ly Pakosta warnt vor pauschalen Altersgrenzen und fordert stattdessen digitale Bildung und Mündigkeit.
„Eine Informationsgesellschaft muss junge Menschen befähigen – nicht ausschließen.“
Auch die Niederlande äußerten Bedenken:
Altersverifikationssysteme greifen stark in die Privatsphäre ein und sollten nur dort eingesetzt werden, wo ein klarer gesetzlicher Rahmen besteht – etwa bei Alkohol oder Glücksspiel.
Belgien stimmte wegen eines Vetos der flämischen Region nicht zu, unterstützt aber grundsätzlich das Ziel eines sichereren Internets.
Pädagogische Perspektive: Bildung bleibt der Schlüssel
Unabhängig von rechtlichen Diskussionen zeigt die Debatte:
Digitale Bildung ist zentral.
Studien belegen, dass hohe Bildschirmzeiten die Konzentration und Schulleistungen beeinflussen können [3].
Aber: Ein Verbot allein schützt nicht.
Kinder müssen verstehen, wie Plattformen funktionieren, welche Strategien sie nutzen – und wie sie sich selbst schützen können.
Das ist eine Aufgabe für Schulen, Eltern und Gesellschaft. Und Medienbildung bleibt die nachhaltigste Form des Jugendschutzes.
Blick nach vorn
Die Jutland Declaration ist ein starkes politisches Signal.
Sie zeigt, dass Europa bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – für eine sichere und faire digitale Zukunft.
Wie sich daraus konkrete Gesetze und technische Lösungen entwickeln, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
Klar ist: Die Debatte um digitale Grenzen und digitale Bildung steht erst am Anfang.
Weiterführende Links
Jutland Declaration (englisches Originaldokument, 2025)
Heise: EU states favour social media ban for children, few dissenters (11.10.2025)
Table.Media: EU-Kommission untersucht Snapchat, Apple und Google (12.10.2025)
Der Standard: Bildschirmzeit und Lernleistung (11.10.2025)