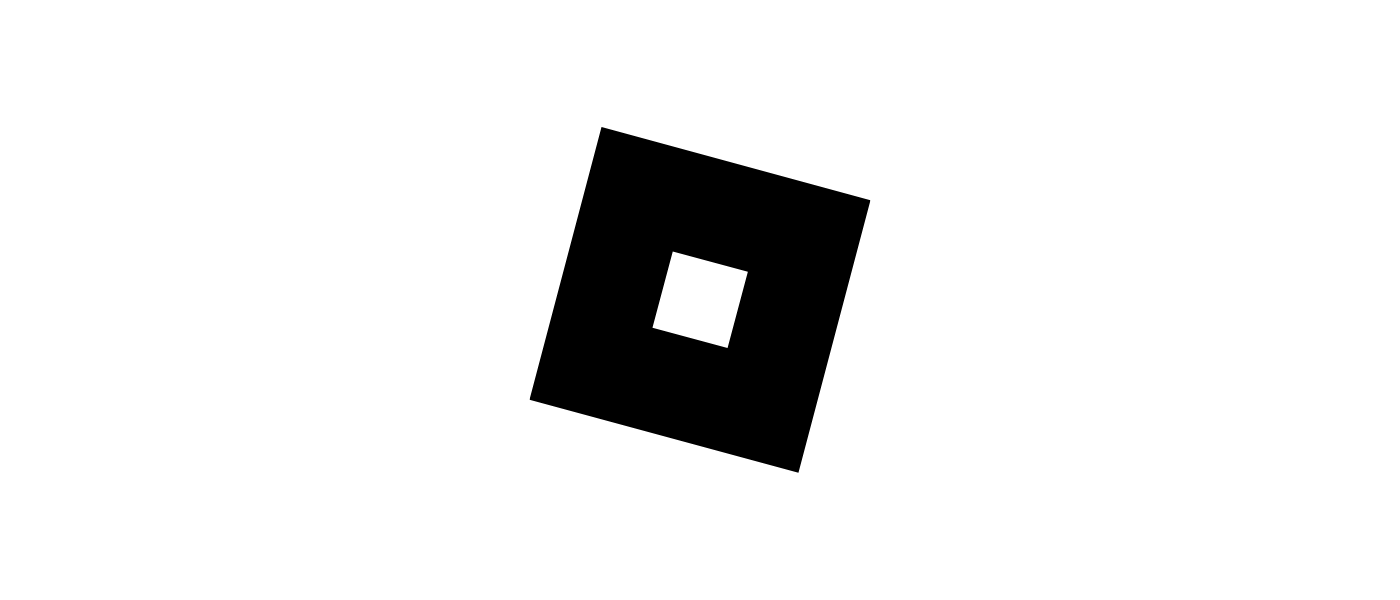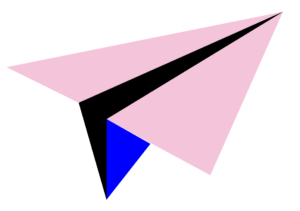Fünf Jahre nach dem Start der Geräteinitiative an Österreichs Schulen zeigt sich ein paradoxes Bild: Während Schüler:innen digitale Medien im Unterricht begrüßen und sich sogar mehr davon wünschen, fühlt sich fast ein Drittel der Lehrkräfte für deren Einsatz nicht ausreichend ausgebildet. Neue Studien offenbaren eine Kluft zwischen technischer Ausstattung und pädagogischer Kompetenz.
Fünf Jahre nach der Einführung des Unterrichtsfachs „Digitale Grundbildung” und dem Start der Geräteinitiative, die Schüler:innen der Unterstufe mit Laptops und Tablets ausstattet, zieht eine aktuelle Studie eine gemischte Bilanz. Die vom Bildungsministerium in Auftrag gegebene Untersuchung „Blick ins Klassenzimmer” der Universität Linz [1] zeigt, dass die Digitalisierung in den Klassenzimmern zwar angekommen ist, die pädagogische Umsetzung jedoch mit erheblichen Herausforderungen verbunden bleibt. Während die technische Ausstattung gute Noten erhält, offenbart der internationale Vergleich erhebliche Unsicherheiten bei den Lehrkräften – und das trotz massiver Investitionen in die digitale Infrastruktur.
Österreichs Schüler:innen als digitale Vorreiter
Die Studie, für die rund 21.400 Schüler:innen und über 2.500 Lehrkräfte befragt wurden, zeichnet aufseiten der Lernenden ein durchwegs positives Bild. Die Mehrheit der Schüler:innen hält digitale Medien für eine sinnvolle Ergänzung des Unterrichts und gibt an, dass diese vom Lehrpersonal auch sinnvoll eingesetzt werden. Mehr noch: Die Kinder wünschen sich sogar einen verstärkten Einsatz der Geräte in mehr Unterrichtsfächern. Aktuell kommen sie vor allem in IT-Fächern, im Sprachunterricht sowie in Mathematik und den Naturwissenschaften zum Einsatz.
Der Einsatz digitaler Werkzeuge scheint sich auch positiv auf die Lernatmosphäre auszuwirken. Die Schüler:innen geben an, motivierter zu sein und sehen keine negativen Auswirkungen auf ihre Konzentration oder den Geräuschpegel in der Klasse. Die meisten sind überzeugt, gut mit den Geräten lernen zu können und sehen einen tatsächlichen Nutzen darin, insbesondere bei der Verwendung von Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen. Diese Begeisterung der Lernenden steht in deutlichem Kontrast zur Unsicherheit vieler Lehrkräfte.
Lehrkräfte zwischen Anspruch und Realität
Auch die befragten Lehrkräfte äußern sich grundsätzlich positiv: Nur wenige planen ihren Unterricht ganz ohne digitale Medien, die Mehrheit findet die Schülergeräte gut. Laut der Befragung setzen die Pädagog:innen digitale Medien in einem Viertel bis zur Hälfte ihrer Stunden ein, vor allem um Inhalte zu vermitteln oder bei Übungen und Aufgaben. Gut zwei Drittel haben laut Eigeneinschätzung genug technische und didaktische Kompetenzen in diesem Bereich. Die Lehrkräfte sehen vielfältige Vorteile für das Lernen und bemühen sich, den Einsatz an das Lernziel anzupassen. Bei der Frage, ob dadurch die Leistungen der Schüler:innen besser werden, bleiben sie jedoch neutral.
Internationale Perspektive: Österreich hinkt hinterher
Dieses auf den ersten Blick positive Bild wird jedoch durch die Ergebnisse der aktuellen TALIS-Studie der OECD deutlich relativiert [2]. Im internationalen Vergleich zeigen sich Österreichs Lehrkräfte deutlich unsicherer und skeptischer gegenüber digitalen Unterrichtsmethoden. Laut der Studie fühlen sich 31 Prozent der Lehrkräfte an Mittelschulen und AHS-Unterstufen durch ihre Ausbildung nicht gut auf den Einsatz digitaler Ressourcen vorbereitet – ein Wert, der deutlich über dem EU-Schnitt von 21 Prozent liegt. Weitere 38 Prozent fühlen sich nur „etwas” vorbereitet, was bedeutet, dass insgesamt mehr als zwei Drittel der österreichischen Lehrkräfte Defizite in ihrer digitalen Ausbildung sehen.
Besonders alarmierend: Selbst unter Junglehrer:innen, die ihr Studium vor maximal fünf Jahren abgeschlossen haben, fühlen sich nur 43 Prozent digital fit für den Unterricht. Dies deutet darauf hin, dass auch die jüngsten Reformen in der Lehramtsausbildung noch nicht ausreichend greifen. Diese Unsicherheit führt dazu, dass österreichische Lehrkräfte digitale Medien vergleichsweise seltener für individualisierte Lernpfade, zur kollaborativen Arbeit der Schüler:innen, zur Beurteilung des Lernfortschritts oder für ihre Unterrichtsplanung einsetzen.
Die Skepsis zeigt sich auch in der Einschätzung der Wirksamkeit: Während drei Viertel der Lehrkräfte glauben, dass digitale Medien das Interesse am Lernen steigern können, erwartet nur die Hälfte, dass Schüler:innen damit effizienter zusammenarbeiten oder ihre Arbeit besser planen lernen. Im EU- und OECD-Schnitt sind es hier jeweils drei Viertel. Dass digitale Medien die Leistung verbessern können, glauben in Österreich nur vier von zehn Lehrkräften – im EU- und OECD-Schnitt sind es sechs von zehn.
|
Vergleich: Digitale Kompetenzen von Lehrkräften (TALIS 2024)
|
Österreich
|
EU-Schnitt
|
|
Fühlen sich nicht gut auf digitalen Unterricht vorbereitet
|
31%
|
21%
|
|
Fühlen sich nur “etwas” vorbereitet
|
38%
|
33%
|
|
Erwarten effizientere Zusammenarbeit durch digitale Medien
|
50%
|
75%
|
|
Erwarten Leistungsverbesserung durch digitale Medien
|
40%
|
60%
|
KI im Klassenzimmer: Potenzial bleibt ungenutzt
Ein weiterer Befund der TALIS-Studie betrifft den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht. Zwar haben 39 Prozent der österreichischen Lehrkräfte bereits KI in ihrer Arbeit verwendet – ein Wert, der dem OECD-Schnitt entspricht. Allerdings nutzen sie diese vor allem für administrative Aufgaben wie das Zusammenfassen von Themen (67 Prozent) oder das Generieren von Unterrichtsplänen (65 Prozent). Für pädagogisch anspruchsvollere Aufgaben wie die Bewertung von Schüler:innenarbeiten (8 Prozent) oder die Analyse von Leistungsdaten (8 Prozent) wird KI kaum eingesetzt.
Von jenen Lehrkräften, die KI noch nicht nutzen, geben 69 Prozent an, nicht über das nötige Wissen und die Fähigkeiten zu verfügen. Der größte Weiterbildungsbedarf besteht laut TALIS-Studie mit 28 Prozent genau in diesem Bereich – bei KI-Fähigkeiten für Lehre und Lernen. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, Lehrkräfte nicht nur für den Umgang mit digitalen Medien, sondern auch für die Integration neuer Technologien wie KI fit zu machen.
Kritische Einordnung: Zwischen technischer Ausstattung und pädagogischem Bedarf
Die Datenlage zeigt eine deutliche Diskrepanz: Österreichs Schulen sind technisch gut ausgestattet – nur vier Prozent der Lehrkräfte beklagen eine Beeinträchtigung der Unterrichtsqualität durch technische Probleme, während es im EU-Schnitt zehn Prozent sind. Gleichzeitig fehlt es aber an der pädagogischen Sicherheit und Ausbildung, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte wünscht sich laut TALIS-Studie zusätzliche Aus- und Weiterbildungsangebote, sowohl zum Einsatz digitaler Medien als auch zu technischen Kompetenzen.
Die größte Hürde für Weiterbildung ist laut 60 Prozent der Befragten fehlende Zeit. Die hohe Arbeitsbelastung, die zu 57 Prozent auf administrative Tätigkeiten zurückgeführt wird, und ein hoher Stresslevel (20 Prozent fühlen sich „viel” gestresst, ein Anstieg um acht Prozentpunkte seit 2018) erschweren die dringend notwendige Professionalisierung. Weitere 56 Prozent geben an, dass Weiterbildungen mit ihrem Arbeitsplan kollidieren, und 44 Prozent bemängeln fehlende Anreize.
Ausblick: Pädagogik muss mit der Technik Schritt halten
Die Ergebnisse legen nahe, dass die reine Bereitstellung von Technologie nicht ausreicht. Um die Digitalisierung im Bildungswesen nachhaltig zu verankern und das volle Potenzial für die Schüler:innen zu heben, müssen die pädagogischen Konzepte und vor allem die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in den Mittelpunkt rücken. Es bedarf gezielter, praxisnaher Fortbildungen, die den Lehrkräften die nötige Sicherheit im Umgang mit digitalen Werkzeugen vermitteln und sie dabei unterstützen, diese didaktisch sinnvoll in ihren Unterricht zu integrieren.
Anmerkung: Konkrete Unterstützungsangebote wie unser Medienführerschein (medienfuehrerschein.at) bieten Lehrkräften bereits heute praxisnahe Materialien und zur Stärkung der Medienkompetenz.
Quellen
[1] Die Presse (2025, 28. Oktober). Digitalisierung an Schulen ist beliebt, Drittel der Lehrer aber unsicher. https://www.diepresse.com/20250057/digitalisierung-an-schulen-ist-beliebt-drittel-der-lehrer-aber-unsicher
[2] OECD (2025). Results from TALIS 2024: Country Note Austria. https://www.oecd.org/en/publications/results-from-talis-2024-country-notes_e127f9e2-en/austria_154ac083-en.html