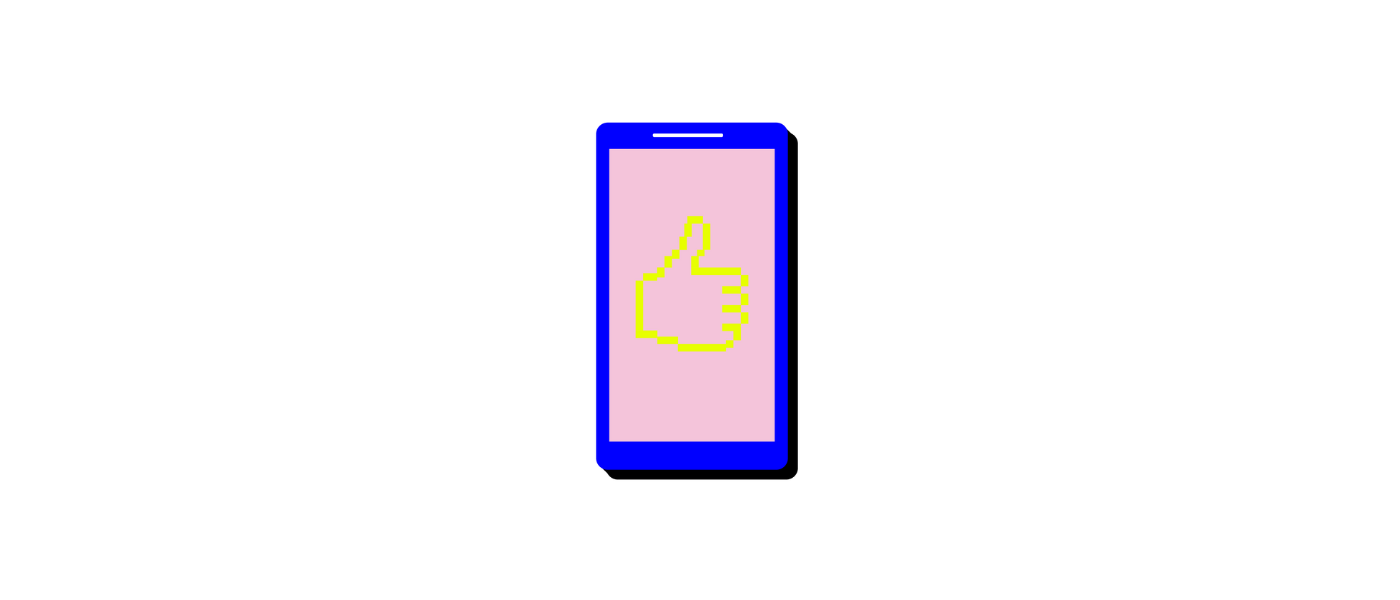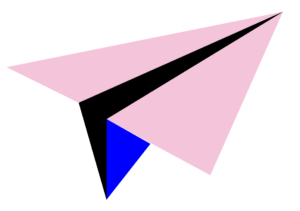Ab Dezember 2025 plant Griechenland den Start des Pilotprojekts „AI in Schools“ – eines der ersten Programme in Europa zur systematischen Integration von KI-Tools im Unterricht. Rund 20 Gymnasien sollen laut Medienberichten mit ChatGPT Edu arbeiten, begleitet von einer mehrstufigen Einführung mit intensiver Lehrerfortbildung und klaren Datenschutzvorgaben. Das ambitionierte Programm wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie gelingt der Spagat zwischen Innovation und Abhängigkeit? Und welche Lehren kann Europa aus unterschiedlichen Ansätzen ziehen?
Das von der griechischen Regierung gemeinsam mit OpenAI und der Onassis Foundation entwickelte Programm positioniert Griechenland als europäischen Bildungspionier. Ein Memorandum of Understanding (MoU) wurde bereits im September 2025 unterzeichnet. Die Onassis Foundation unterstützt das Projekt finanziell, OpenAI stellt die Technologie mit ChatGPT Edu bereit [1][2].
Der pädagogische Ansatz stellt Lehrkräfte in den Mittelpunkt: Die erste Projektphase konzentriert sich ausschließlich auf ihre Qualifizierung, bevor Schüler:innen überhaupt mit dem System arbeiten [1]. Damit unterscheidet sich Griechenland von vielen anderen Ländern, die bislang eher unkoordiniert einzelne KI-Tools im Unterricht testen.
Ein ambitionierter Ansatz mit klarer Struktur
Das griechische Modell setzt auf Systematik. Lehrkräfte werden zunächst geschult, anschließend folgen kontrollierte Unterrichtsphasen und eine begleitende Evaluation. Der genaue Zeitplan ist laut Bildungsministerium noch in Abstimmung, soll aber Ende 2025 beginnen [1].
ChatGPT Edu bietet Funktionen speziell für Bildungseinrichtungen: eine werbefreie Umgebung, zentrale Verwaltung über Bildungskonten und die Möglichkeit für Lehrkräfte, eigene „Custom GPTs“ zu erstellen – also spezialisierte Lern-Assistenten für einzelne Fächer [1].
Auch beim Datenschutz setzt Griechenland auf hohe Standards. Das Bildungsministerium bereitet derzeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) vor und will formelle Vereinbarungen mit OpenAI abschließen, die eine Weitergabe oder kommerzielle Nutzung von Daten ausschließen. OpenAI selbst erklärt, dass Daten in ChatGPT Edu nicht für Trainingszwecke verwendet werden und alle Interaktionen verschlüsselt erfolgen [1]. Dennoch müssen die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten werden, insbesondere was Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeitung und Drittlandtransfer betrifft.
Finnland: Der europäische Vergleichsmaßstab
Während Griechenland auf ein konkretes KI-Tool setzt, verfolgt Finnland seit Jahren einen anderen Ansatz. Dort ist Medien- und Informationskompetenz seit 2014 fester Bestandteil des Lehrplans [4]. Der finnische Ansatz ist technologie-neutral und auf die Stärkung kritischer Kompetenzen ausgerichtet: Wie erkenne ich vertrauenswürdige Quellen? Wie funktionieren Algorithmen? Welche wirtschaftlichen Interessen stehen hinter Plattformen?
Dieser Ansatz hat Finnland zu einem der widerstandsfähigsten Länder gegen Desinformation gemacht. Die Kompetenzen sind nicht an einzelne Technologien gebunden, sondern übertragbar auf neue Entwicklungen.
Bildungsforscher wie Michael Reicho von der Universität Graz betonen, dass Medienkompetenz weit über die Bedienung einzelner Tools hinausgeht: Es geht um das Verständnis von Plattformlogiken, Manipulationsmechanismen und die Reflexion der eigenen digitalen Identität [4]. Solche Fähigkeiten lassen sich nicht durch die Schulung auf ein einzelnes Produkt vermitteln, sondern erfordern einen breiteren pädagogischen Ansatz.
Zwei Wege, ein Ziel: Produktschulung oder breite Kompetenz?
Der Vergleich zwischen dem griechischen und dem finnischen Modell wirft eine zentrale Frage auf: Was ist zukunftsfähiger – die Integration eines leistungsfähigen KI-Tools mit praxisnaher Schulung oder die Vermittlung breiter, technologieunabhängiger Kompetenzen?
Für das griechische Modell spricht die Praxisnähe: Lehrkräfte und Schüler:innen arbeiten mit einem realen KI-System, sammeln Erfahrungen und können die Technologie gezielt für Lernprozesse einsetzen.
Kritisch bleibt jedoch die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter. ChatGPT Edu ist ein proprietäres Produkt eines US-Unternehmens. Trotz aller Datenschutzvereinbarungen besteht eine strukturelle Unsicherheit, etwa bei Änderungen von Geschäftsmodellen oder rechtlichen Rahmenbedingungen. Der US-amerikanische CLOUD Act kann unter bestimmten Voraussetzungen Behördenzugriff auf Daten US-basierter Anbieter ermöglichen – eine rechtliche Grauzone, die unabhängig von einzelvertraglichen Zusagen bleibt.
Zudem stellt sich die Frage, ob die intensive Schulung auf ein spezifisches Tool tatsächlich breite KI-Kompetenz vermittelt oder primär effiziente Produktnutzung trainiert. Zwischen „wissen, wie ChatGPT funktioniert“ und „verstehen, wie generative KI grundsätzlich arbeitet“ liegt ein entscheidender Unterschied.
Die österreichische Perspektive: Digitale Grundbildung als Mittelweg?
Österreich verfolgt mit dem Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ (seit 2022/23) einen Ansatz, der zwischen dem griechischen und dem finnischen Modell liegt. Der Lehrplan zielt auf breite digitale Kompetenzen, ohne sich auf einzelne Anbieter festzulegen. Gleichzeitig ist die praktische Umsetzung herausfordernd, wie Doris Kurus, Direktorin des Schulverbunds Klingenberg (OÖ), betont: „Ein Schulbuch braucht drei Jahre, bis es einsatzbereit ist – vor drei Jahren gab es ChatGPT noch gar nicht.“ [4]
Ein österreichisches Gegenmodell für strukturiert aufgebaute Medien- und KI-Bildung ist der Medienführerschein Österreich (www.medienfuehrerschein.at). Das Programm vermittelt über vier aufeinander aufbauende Jahrgänge praxisnahe Kompetenzen zu Themen wie Datenschutz, digitale Kommunikation, kritisches Denken und bewusster Technologiekonsum. Es verfolgt damit genau jenen herstellerunabhängigen Ansatz, den viele Bildungsexpert:innen als zentral ansehen – und könnte als österreichische Ergänzung zu internationalen KI-Initiativen dienen.
Diese Spannung zwischen Aktualität und Lehrplanrealität bleibt zentral. Griechenland wählt den pragmatischen Weg der Tool-Integration, Finnland den langfristigeren Kompetenzansatz.
Mit dem AI Act hat die EU inzwischen einen Rechtsrahmen geschaffen, der KI-Systeme in Bildungseinrichtungen unter bestimmten Umständen als Hochrisiko-Anwendungen einstuft (Art. 6 i. V. m. Anhang III). Anwendungen wie Emotionserkennung bei Schüler:innen sind ausdrücklich verboten [5]. Diese Regeln sind wichtig, lösen aber die Abhängigkeitsfrage nicht: Solange Europa keine eigenen, öffentlich kontrollierten KI-Lösungen entwickelt, bleibt die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern bestehen.
Ausblick: Von beiden Ansätzen lernen
Griechenlands Experiment dürfte ab Ende 2025 wertvolle Erkenntnisse liefern – sowohl über Chancen als auch über Risiken der systematischen KI-Integration. Andere EU-Staaten werden beobachten, wie sich Unterricht, Lernerfolge und rechtliche Praxis entwickeln.
Die Zukunft könnte in einer Kombination beider Ansätze liegen: breite, technologieunabhängige Medien- und KI-Kompetenz nach finnischem Vorbild als Fundament, ergänzt durch praktische Erfahrungen mit aktuellen Tools – idealerweise mit europäischen oder Open-Source-Lösungen.
Quellen
[1] Koutroumpis, John. “Greece Launches ‘AI in Schools’ Program to Bring ChatGPT Edu Into Classrooms.” Greek Reporter, 18. Oktober 2025. [2] “OpenAI for Greece.” OpenAI Global Affairs Blog, September 2025. [3] “Microsoft launches AI education initiative in Washington state.” MSN, 18. Oktober 2025. [4] Nimmervoll, Lisa. “Im digitalen Dschungelcamp: Wie Schulen gegen Fakes und Filterblasen kämpfen.” Der Standard, 17. Oktober 2025. [5] “AI Act | Shaping Europe’s Digital Future.” Europäische Kommission, 13. Oktober 2025.