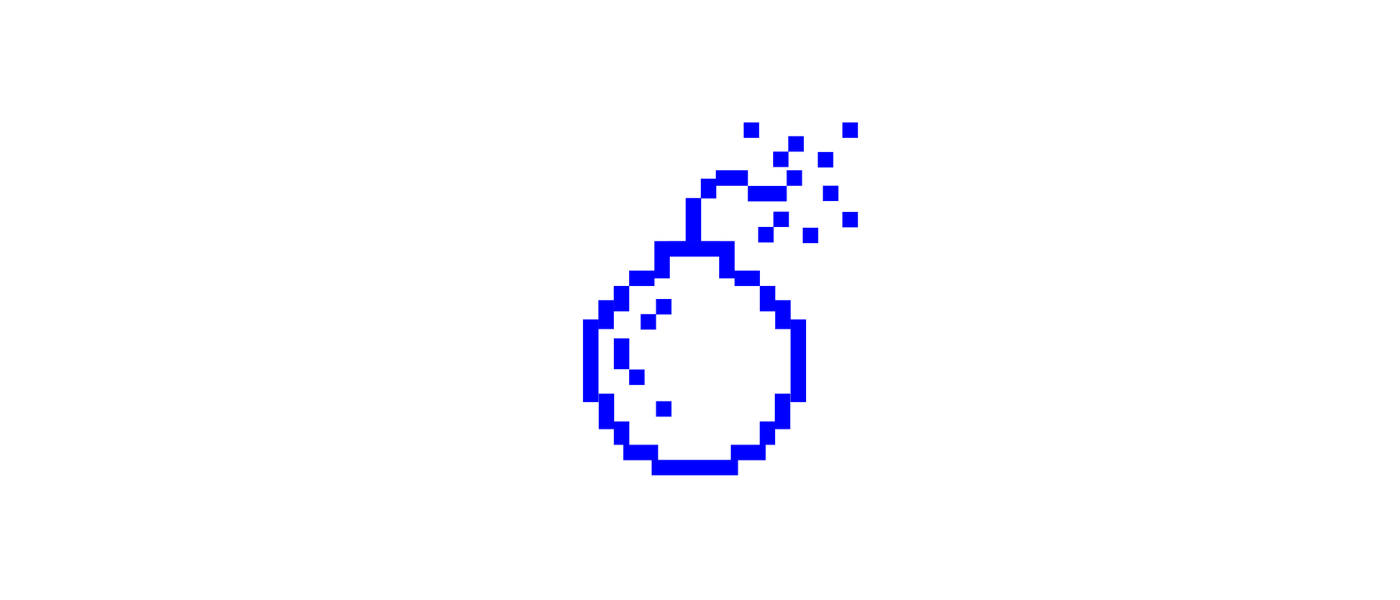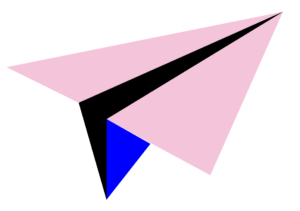Info vorab: Lehrkräfte, die dieses Thema im Unterricht behandeln möchten, finden auf medienbildung.at/stundenbilder/ kostenlose, praxiserprobte Unterrichtsmaterialien. Die Stundenbilder-Sammlung wird durch die Initiative gscheit digital gefördert und bietet fertig ausgearbeitete Konzepte für verschiedene Schulstufen. Die Materialien sind direkt einsetzbar und orientieren sich an den aktuellen Lehrplänen.
Info vorab: Lehrkräfte, die dieses Thema im Unterricht behandeln möchten, finden auf medienbildung.at/stundenbilder/ kostenlose, praxiserprobte Unterrichtsmaterialien. Die Stundenbilder-Sammlung wird durch die Initiative gscheit digital gefördert und bietet fertig ausgearbeitete Konzepte für verschiedene Schulstufen. Die Materialien sind direkt einsetzbar und orientieren sich an den aktuellen Lehrplänen.Als Maria das Foto ihrer achtjährigen Tochter beim Schulfest auf Facebook postet, ahnt sie nicht, dass sie damit möglicherweise gegen das Recht ihrer Tochter verstößt. Als Thomas ein KI-generiertes Bild für seine Firma verwendet, weiß er nicht, dass er persönlich dafür haftet, falls das Bild Urheberrechte verletzt. Und als Sophie ein fremdes Foto für ihren Blog verwendet, weil sie es “im Internet gefunden” hat, begeht sie eine Urheberrechtsverletzung – selbst wenn keine Copyright-Notiz sichtbar war. Bildrechte im digitalen Zeitalter sind ein Minenfeld aus verschiedenen Rechtsbereichen, die sich überschneiden und manchmal widersprechen. Dieser Artikel erklärt, wer welche Rechte an Bildern hat und was das für den Alltag bedeutet.
Das Urheberrecht: Wem gehört das Foto?
Das Urheberrecht ist das älteste und bekannteste Recht im Zusammenhang mit Bildern. Es besagt: Wer ein Foto macht, ist automatisch Urheberinnen oder Urheber und besitzt damit alle Rechte an diesem Bild. Dieser Schutz entsteht im Moment der Aufnahme – es ist keine Registrierung, kein Copyright-Vermerk und keine Anmeldung nötig [1]. Das österreichische Urheberrechtsgesetz (UrhG) schützt Werke der Literatur, Kunst und Wissenschaft, wenn sie eine “eigene geistige Schöpfung” darstellen (§ 1 UrhG) [2]. Bei Fotos ist diese Hürde in der Regel erfüllt, sobald die Fotografin oder der Fotograf kreative Entscheidungen trifft – etwa bei Bildausschnitt, Belichtung oder Perspektive.
Das bedeutet konkret: Jedes Foto, das jemand macht, gehört dieser Person. Andere dürfen es nicht ohne Erlaubnis verwenden, kopieren, bearbeiten oder veröffentlichen. Das gilt auch für Bilder, die “im Internet gefunden” wurden. Die weit verbreitete Annahme, dass Bilder ohne sichtbaren Copyright-Vermerk frei verwendbar seien, ist ein gefährlicher Irrtum.
Urheberrechtsverletzungen können zu Abmahnungen, Unterlassungsklagen und erheblichen Schadenersatzforderungen führen [3]. Professionelle Agenturen und Fotografinnen und Fotografen setzen zunehmend auf automatisierte Überwachungssysteme, die das Internet nach unerlaubten Verwendungen durchsuchen.
Bei Social Media wird es komplizierter. Wer ein Foto auf Instagram, Facebook oder TikTok hochlädt, behält zwar das Urheberrecht, räumt der Plattform aber weitreichende Nutzungsrechte ein. Die Plattformen dürfen die Bilder speichern, anzeigen, verbreiten und für Werbezwecke nutzen – allerdings nur im Rahmen ihrer Dienste [4]. Das Urheberrecht bleibt bei der Person, die das Foto gemacht hat, aber die Kontrolle über die Verwendung wird eingeschränkt. Wer Bilder anderer Nutzerinnen und Nutzer teilen möchte, braucht deren Erlaubnis – auch wenn die Plattform technisch ein einfaches Teilen ermöglicht.
Das Recht am eigenen Bild: Wer entscheidet über Veröffentlichungen?
Parallel zum Urheberrecht existiert ein zweites, völlig unabhängiges Recht: das Recht am eigenen Bild. Es ist ein Persönlichkeitsrecht, ähnlich dem Namensrecht, und besagt, dass Bilder von Personen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen, wenn dadurch berechtigte Interessen der abgebildeten Person verletzt würden [5]. Dieses Recht steht der fotografierten Person zu, nicht der Fotografin oder dem Fotografen. Selbst wenn jemand das Urheberrecht an einem Foto besitzt, darf diese Person es nicht veröffentlichen, wenn die abgebildete Person nicht zustimmt.
Die österreichische Rechtslage ist hier eindeutig: Da schwer beurteilt werden kann, ob eine Veröffentlichung berechtigte Interessen verletzt, sollte in jedem Fall die Zustimmung der abgebildeten Person eingeholt werden [5]. Dabei sind nicht nur das Bild selbst, sondern auch Bildunterschriften, Begleittexte und der Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen. Ein Foto, das in einem Kontext harmlos erscheint, kann in einem anderen Kontext – etwa mit einer irreführenden Überschrift – die Rechte der abgebildeten Person verletzen. Bei nicht-genehmigter Verwendung für Werbezwecke liegt regelmäßig eine Verletzung vor.
Wer von unerwünschten Bildern im Netz betroffen ist, kann sich an die Internet Ombudsstelle wenden. Die Plattform “Mein Bild im Netz” beantwortet Fragen rund um Bildveröffentlichungen und Persönlichkeitsrechte und berät kostenlos über mögliche Maßnahmen [5]. Betroffene sollten zunächst die Websitebetreiberin oder den Websitebetreiber zur Löschung auffordern, Fotos auf sozialen Netzwerken melden, Beweise durch Screenshots sichern und bei Bedarf rechtliche Schritte einleiten. Das Recht am eigenen Bild wird durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zusätzlich gestärkt, da Fotos personenbezogene Daten darstellen und deren Verarbeitung besonderen Regeln unterliegt.
Kinderfotos: Warum Eltern nicht einfach entscheiden dürfen
Ein besonders sensibler Bereich sind Kinderfotos. Viele Eltern gehen davon aus, dass sie für ihre Kinder entscheiden dürfen, welche Fotos veröffentlicht werden. Rechtlich ist das jedoch falsch. Das Recht am eigenen Bild gilt als “höchstpersönliches Recht” – es kann nur von der betroffenen Person selbst wahrgenommen werden, nicht von einer anderen Person [6]. Das bedeutet: Wenn für die Veröffentlichung eines Bildnisses die Zustimmung der abgebildeten Person notwendig ist, muss diese Person selbst zustimmen. Bei Kinderfotos muss also das Kind selbst der Veröffentlichung zustimmen; Eltern können nicht für das Kind die Zustimmung erteilen.
Ein Kind kann allerdings erst dann wirksam zustimmen, wenn es über die notwendige “Entscheidungsfähigkeit” verfügt – also die Konsequenzen einer solchen Zustimmung versteht. In den meisten Fällen liegt diese Entscheidungsfähigkeit, abhängig vom Reifegrad des Kindes, ungefähr ab dem 14. Lebensjahr vor [6]. Manche Kinder erreichen diesen Reifegrad früher, manche später. Ab Eintritt der Entscheidungsfähigkeit reicht es aus, wenn das Kind allein einer Veröffentlichung zustimmt – die Eltern müssen nicht mehr gefragt werden.
Wenn das Kind diesen Reifegrad noch nicht erreicht hat, kommt es darauf an, ob durch die Veröffentlichung berechtigte Interessen des Kindes verletzt werden. Die Einschätzung der Eltern spielt dabei eine Rolle, da sie die Situation des Kindes üblicherweise am besten beurteilen können. Dennoch können Eltern rechtlich keine wirksame Einwilligung für das Kind erteilen. Besonders wichtig: Für das Kind nachteilige Fotos dürfen jedenfalls nicht veröffentlicht werden, und die Zustimmung der Eltern ist in solchen Fällen niemals wirksam [6]. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat dies in einer Entscheidung (15 Os 176/15v) klargestellt: Eine Mutter durfte das Foto ihrer verletzten Tochter nicht an eine Zeitung weitergeben, um auf Missstände in der Schule aufmerksam zu machen, da dies die berechtigten Interessen des Kindes verletzte.
KI-generierte Bilder: Wem gehört das, was keine Person geschaffen hat?
Mit dem Aufstieg generativer KI-Systeme wie DALL·E, Midjourney oder Stable Diffusion entsteht eine völlig neue Frage: Wem gehören Bilder, die keine menschliche Person geschaffen hat? Die Antwort der Rechtsprechung in Österreich, Deutschland und den USA ist eindeutig: KI-generierte Bilder genießen grundsätzlich keinen urheberrechtlichen Schutz [2][7]. Der Grund liegt in einem Grundprinzip des Urheberrechts: Es schützt nur menschliche Schöpfungen. Das US Copyright Office stellte im Januar 2025 in einem umfassenden Bericht klar, dass “menschliche Urheberschaft ein Grundpfeiler der Schutzfähigkeit” sei und Werke, die vollständig von KI generiert wurden, nicht urheberrechtlich geschützt werden können [7].
Das bedeutet konkret: Wer einen Prompt in eine KI eingibt und ein Bild generiert, erwirbt kein Urheberrecht an diesem Bild. Die bloße Auswahl von Stichworten reicht nicht aus, um den erforderlichen menschlichen Schöpfungsakt zu begründen. Das Bild ist damit gemeinfrei – theoretisch könnte es jede und jeder verwenden. In der Praxis ist die Situation komplexer, denn viele KI-Anbieter regeln in ihren Nutzungsbedingungen, wer welche Rechte an generierten Bildern erhält. Manche Anbieter räumen den Nutzerinnen und Nutzern exklusive Nutzungsrechte ein, andere behalten sich eigene Rechte vor.
Eine Ausnahme vom fehlenden Urheberrechtsschutz besteht, wenn ein Mensch eine schöpferische Auswahl, Gestaltung oder Nachbearbeitung vornimmt, die den Schutz begründet [2]. Wer also ein KI-generiertes Bild erheblich bearbeitet, kombiniert oder in ein größeres Werk einbettet, kann möglicherweise Urheberrechtsschutz für das Gesamtwerk beanspruchen – nicht für das KI-Bild selbst, aber für die eigene schöpferische Leistung.
Die Haftungsfalle: Wer trägt die Verantwortung für KI-Bilder?
Auch wenn KI-generierte Bilder selbst nicht urheberrechtlich geschützt sind, bedeutet das nicht, dass ihre Verwendung risikofrei ist. Im Gegenteil: Die Person, die ein KI-generiertes Bild verwendet, trägt die volle rechtliche Verantwortung [2][8]. Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die KI-Systeme mit Millionen urheberrechtlich geschützter Bilder trainiert wurden. Wenn die generierte Ausgabe erkennbar auf einem konkreten geschützten Werk basiert, kann dies eine Urheberrechtsverletzung darstellen (§ 14 UrhG – unfreie Bearbeitung). In solchen Fällen haftet der Endnutzer oder die Endnutzerin, nicht der KI-Anbieter.
Noch problematischer wird es, wenn KI-Bilder real existierende Personen darstellen oder nachahmen. Solche Bilder können das Recht am eigenen Bild (§ 78 UrhG) oder datenschutzrechtliche Persönlichkeitsrechte verletzen (Artikel 8 EMRK, DSGVO) [2]. Dies gilt besonders für Deepfakes oder realitätsnahe Porträts. Die Veröffentlichung ohne Einwilligung der dargestellten Person kann zu zivilrechtlichen Ansprüchen führen – etwa auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz. Die Tatsache, dass das Bild von einer KI generiert wurde, ändert nichts daran, dass die Persönlichkeitsrechte der dargestellten Person geschützt sind.
Die Person, die ein KI-generiertes Bild verwendet, muss daher sicherstellen, dass keine fremden Urheberrechte verletzt werden, keine Persönlichkeitsrechte betroffen sind und keine irreführende oder rechtswidrige Verwendung vorliegt [2]. Im Schadensfall haftet die Nutzerin oder der Nutzer nach den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln (§§ 1293 ff ABGB). Viele KI-Anbieter schließen die Haftung für etwaige Rechtsverletzungen durch generierte Inhalte vertraglich aus oder beschränken sie erheblich. Das Risiko liegt damit vollständig bei der Person, die das Bild verwendet.
Praktische Empfehlungen: Wie Bildrechte respektiert werden können
Um Haftungsrisiken zu minimieren und Rechte anderer zu respektieren, sollten einige grundlegende Regeln beachtet werden. Bei der Verwendung fremder Fotos gilt: Immer die Erlaubnis der Urheberinnen oder Urheber einholen. Kostenlose Bilddatenbanken wie Unsplash oder Pixabay bieten Fotos unter freien Lizenzen an, aber auch hier sollten die Lizenzbedingungen genau gelesen werden. Bei Fotos von Personen muss zusätzlich die Zustimmung der abgebildeten Person vorliegen – das Urheberrecht der Fotografin oder des Fotografen allein reicht nicht aus.
Bei Kinderfotos ist besondere Vorsicht geboten. Eltern sollten sich bewusst sein, dass sie rechtlich nicht für ihre Kinder entscheiden können, auch wenn dies in der Praxis oft anders gehandhabt wird. Spätestens ab dem 14. Lebensjahr sollten Kinder selbst gefragt werden. Generell gilt: Je älter das Kind, desto wichtiger ist seine eigene Meinung. Fotos, die das Kind in peinlichen, verletzlichen oder nachteiligen Situationen zeigen, sollten grundsätzlich nicht veröffentlicht werden – unabhängig vom Alter.
Bei KI-generierten Bildern empfehlen Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten folgende Maßnahmen [2][8]: Transparenz über die Herkunft der Bilder schaffen (Nutzungshinweise, Quellenangabe, Tool-Benennung), keine Bilder verwenden, die realen Personen nachempfunden sind, ohne deren Einwilligung, eine Rechtsprüfung im Einzelfall durchführen (besonders bei kommerzieller Nutzung), vertragliche Absicherung durch Lizenzvereinbarungen und Prüfung der AGB der KI-Plattform sowie Kennzeichnungspflichten beachten. Je nach Kontext – etwa bei politischer Werbung – kann eine Offenlegung, dass ein Bild KI-generiert ist, geboten oder sogar verpflichtend sein.
Ausblick: Offene Fragen und zukünftige Entwicklungen
Die rechtliche Landschaft rund um Bildrechte ist im Wandel. Die Europäische Union hat mit der Copyright-Richtlinie im digitalen Binnenmarkt (2019) bereits Schritte unternommen, um das Urheberrecht an die digitale Realität anzupassen [9]. Artikel 17 der Richtlinie macht Plattformen wie YouTube, Facebook und andere Social-Media-Websites für von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladene Inhalte verantwortlich. Das bedeutet: Die Plattformen müssen aktiv sicherstellen, dass keine Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Diese Regelung ist umstritten, da sie zu Upload-Filtern und möglicher Überzensur führen kann.
Bei KI-generierten Bildern sind viele Fragen noch offen. Sollten KI-Systeme nur mit Bildern trainiert werden dürfen, für die eine Lizenz vorliegt? Wer haftet, wenn eine KI ein Bild generiert, das einem geschützten Werk zu ähnlich ist? Sollten KI-generierte Bilder verpflichtend gekennzeichnet werden müssen? Verschiedene Länder experimentieren mit unterschiedlichen Ansätzen. China hat im November 2023 als erstes Land ein Gericht entschieden, dass ein KI-generiertes Bild urheberrechtlich geschützt sein kann, sofern der Nutzer oder die Nutzerin ausreichend kreative Entscheidungen getroffen hat [7]. Ob sich dieser Ansatz durchsetzt, bleibt abzuwarten.
Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet die komplexe Rechtslage vor allem eines: Vorsicht und Aufmerksamkeit sind geboten. Wer Bilder verwendet, sollte sich bewusst sein, dass mehrere Rechte betroffen sein können – das Urheberrecht der Fotografin oder des Fotografen, das Recht am eigenen Bild der abgebildeten Person und möglicherweise weitere Rechte. Im Zweifelsfall sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, denn die Konsequenzen von Rechtsverletzungen können erheblich sein. Die gute Nachricht: Mit etwas Umsicht und Respekt für die Rechte anderer lassen sich die meisten Probleme vermeiden.
Quellen
[1] Small Business Xchange. (2025, 6. August). How Small Businesses Can Avoid Copyright Mistakes Online. https://smallbusinessxchange.com/news/copyright-laws-social-media/131494/
[2] KOMMUNAL. (2025, 30. Juli). Die Haftungsfrage bei KI-generierten Bildern. https://kommunal.at/die-haftungsfrage-bei-ki-generierten-bildern
[3] Sandberg Phoenix. (2025, 10. September). Internet Images Are Free, Right (or Wrong)? https://sandbergphoenix.com/internet-images-are-free-right-or-wrong/
[4] EmbedSocial. (2025, 7. Februar). UGC Rights Management: How to Request Image Usage Permission. https://embedsocial.com/blog/ugc-rights-management/
[5] oesterreich.gv.at. (2025, 24. Juli). Das Recht am eigenen Bild. https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/onlinesicherheit_internet_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/7/Seite.1720440
[6] Internet Ombudsstelle. (2025, 4. August). Wer muss bei der Veröffentlichung von Kinderfotos zustimmen? https://www.ombudsstelle.at/mein-bild-im-netz/wer-muss-bei-der-veroeffentlichung-von-kinderfotos-zustimmen/
[7] US Copyright Office. (2025, 29. Januar). Copyright and Artificial Intelligence – Part 2. https://www.copyright.gov/ai/
[8] specialis. (2025, 6. Mai). Rechte an KI-Inhalten: 5 Punkte, die Unternehmen unbedingt beachten sollten. https://www.specialis.at/post/rechte-an-ki-inhalten-5-punkte-die-unternehmen-unbedingt-beachten-sollten
[9] European Commission. EU copyright law – Directive on Copyright in the Digital Single Market. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation