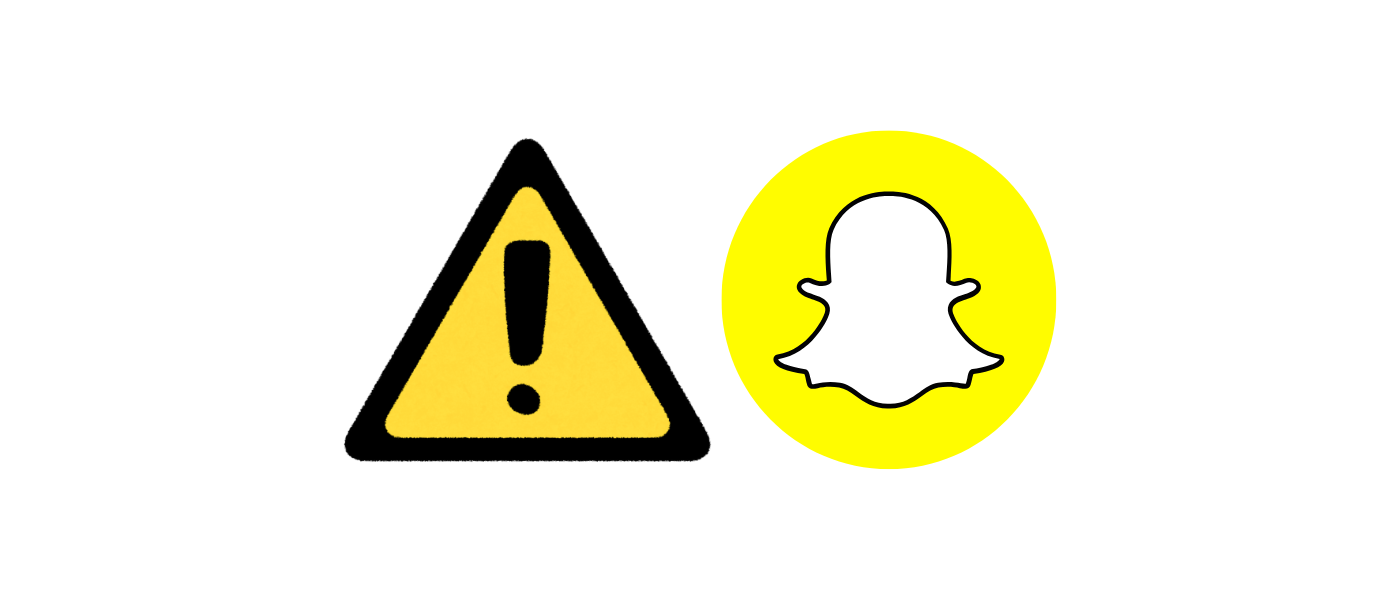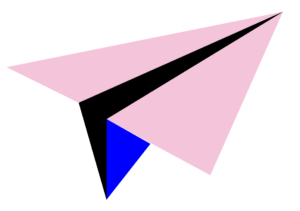Die Europäische Kommission hat erstmals konkrete Untersuchungen gegen große Online-Plattformen wie YouTube, Snapchat, Apple und Google eingeleitet, um deren Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen zu überprüfen. Im Fokus stehen Altersverifikation und Zugang zu schädlichen Inhalten – ein Schritt, der angesichts der hohen Nutzung dieser Dienste durch österreichische Jugendliche weitreichende Folgen hat.
Hintergrund
Knapp drei Monate nach der Veröffentlichung neuer, strengerer Leitlinien zum Jugendschutz im Rahmen des Digital Services Act (DSA) hat die EU-Kommission am 10. Oktober 2025 offizielle Auskunftsersuchen an vier der größten Digitalkonzerne versandt [1].
Untersucht wird, ob die Plattformen ihrer Verpflichtung nachkommen, ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz für minderjährige Nutzer:innen zu gewährleisten.
Für österreichische Eltern und Lehrkräfte ist dies eine Nachricht von hoher Relevanz – denn YouTube, Snapchat & Co. dominieren den digitalen Alltag junger Menschen im Land.
Österreichische Jugendliche im Fokus der Regulierer
Die Zahlen des Jugend-Internet-Monitors 2025 zeichnen ein klares Bild:
- 80 % der 11- bis 17-jährigen Österreicher:innen nutzen regelmäßig YouTube,
- 74 % sind auf Snapchat aktiv [2].
Damit gehören beide Plattformen zu den Top 3 der beliebtesten Netzwerke dieser Altersgruppe – und geraten nun ins Zentrum der EU-Ermittlungen.
Die Kommission will wissen, wie Altersverifikationssysteme funktionieren und wie verhindert wird, dass Minderjährige auf illegale oder gesundheitsgefährdende Inhalte (z. B. Drogen, Vapes, Essstörungs-Inhalte) zugreifen können.
Auch die App Stores von Apple und Google werden geprüft – insbesondere im Hinblick auf schädliche Apps wie Glücksspiel- oder „Nudify“-Anwendungen, mit denen sich nicht-einvernehmliche Nacktbilder erstellen lassen.
„Wir werden alles tun, um das physische und psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen online zu gewährleisten. Das fängt bei den Online-Plattformen an. Sie haben die Pflicht sicherzustellen, dass Minderjährige auf ihren Diensten sicher sind.“ — Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für Tech-Souveränität der Europäischen Kommission [1]
Die Rolle der KommAustria
Die Durchsetzung des Digital Services Act ist keine alleinige Aufgabe Brüssels.
In Österreich spielt die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) als nationale Koordinatorin für digitale Dienste eine Schlüsselrolle.
Sie überwacht die Einhaltung der neuen Regeln bei allen in Österreich ansässigen Anbietern und arbeitet eng mit der EU-Kommission sowie anderen Mitgliedstaaten zusammen [3].
Die aktuellen Untersuchungen zeigen: Die Zeit der freiwilligen Selbstverpflichtungen ist vorbei.
Die neuen DSA-Leitlinien (veröffentlicht im Juli 2025) geben den Behörden erstmals konkrete Werkzeuge an die Hand.
Neue EU-Leitlinien im Überblick
| Private Konten als Standard | Konten von Minderjährigen müssen standardmßprivat sein, um Kontaktrisiken zu minimieren. |
| Verbot manipulativer Designs | Suchtfördende Mechanismen wie Infinite Scrolling oder exzessive Push-Nachrichten sollen eingeschränkt werden. |
| KI-Beschränkungen | Der Einsatz von KI-Chatbots als primäres Kommunikationsmittel mit Minderjährigen wird verboten. |
| Strenge Altersverifikation | Eine einfache Altersabfrage per Klick gilt nicht mehr als ausreichend. Für risikoreiche Dienste (z. B. Pornografie, Glücksspiel) werden robuste Verifikationssysteme zur Pflicht. |
| Transparente Empfehlungen | Empfehlungsalgorithmen dürfen nicht mehr auf Verhaltensdaten basieren, sondern müssen sich auf explizite Nutzersignale stützen. |
Internationale Perspektive
Die EU geht mit gutem Beispiel voran:
Während ähnliche Debatten in den USA oft in politischen Blockaden enden, schafft Europa mit dem Digital Services Act einen verbindlichen Rechtsrahmen.
Die laufenden Untersuchungen gegen YouTube, Snapchat, Apple und Google signalisieren klar:
Kinderschutz ist keine freiwillige Option, sondern rechtliche Verpflichtung.
Kritische Einordnung & Ausblick
Die Umsetzung wird zur Bewährungsprobe.
Technisch robuste Altersverifikationssysteme sind komplex – die EU arbeitet an einer datenschutzfreundlichen Lösung („EU AV-App“) im Machbarkeits- und Teststadium [3].
Für Eltern und Lehrkräfte bedeutet das:
Digitale Umgebungen werden sicherer, aber Verantwortung bleibt geteilt.
Begleitung, Aufklärung und Medienkompetenz-Förderung bleiben entscheidend – die besten Schutzmechanismen sind jene, die Kinder verstehen und selbst anwenden können.
Info für Eltern & Lehrkräfte
Mehr Unterrichtsmaterialien zum Thema „Digitale Sicherheit und Jugendschutz“ finden Sie auf
www.medienbildung.at/stundenbilder
Quellen
[1] Europäische Kommission (10. Oktober 2025). Commission scrutinises safeguards for minors on Snapchat, YouTube, Apple App Store and Google Play under the Digital Services Act. [2] Jugend-Internet-Monitor (2025). Die Social-Media-Nutzung von Jugendlichen in Österreich. Zitiert nach diversen Medienberichten und Statista. [3] RTR / KommAustria (14. Juli 2025). KommAustria informiert über neue Leitlinien der Europäischen Kommission für verbesserten Online-Jugendschutz.